Audiovisuelle Medien: Rezeption, Inkorporation und kreatives Produzieren
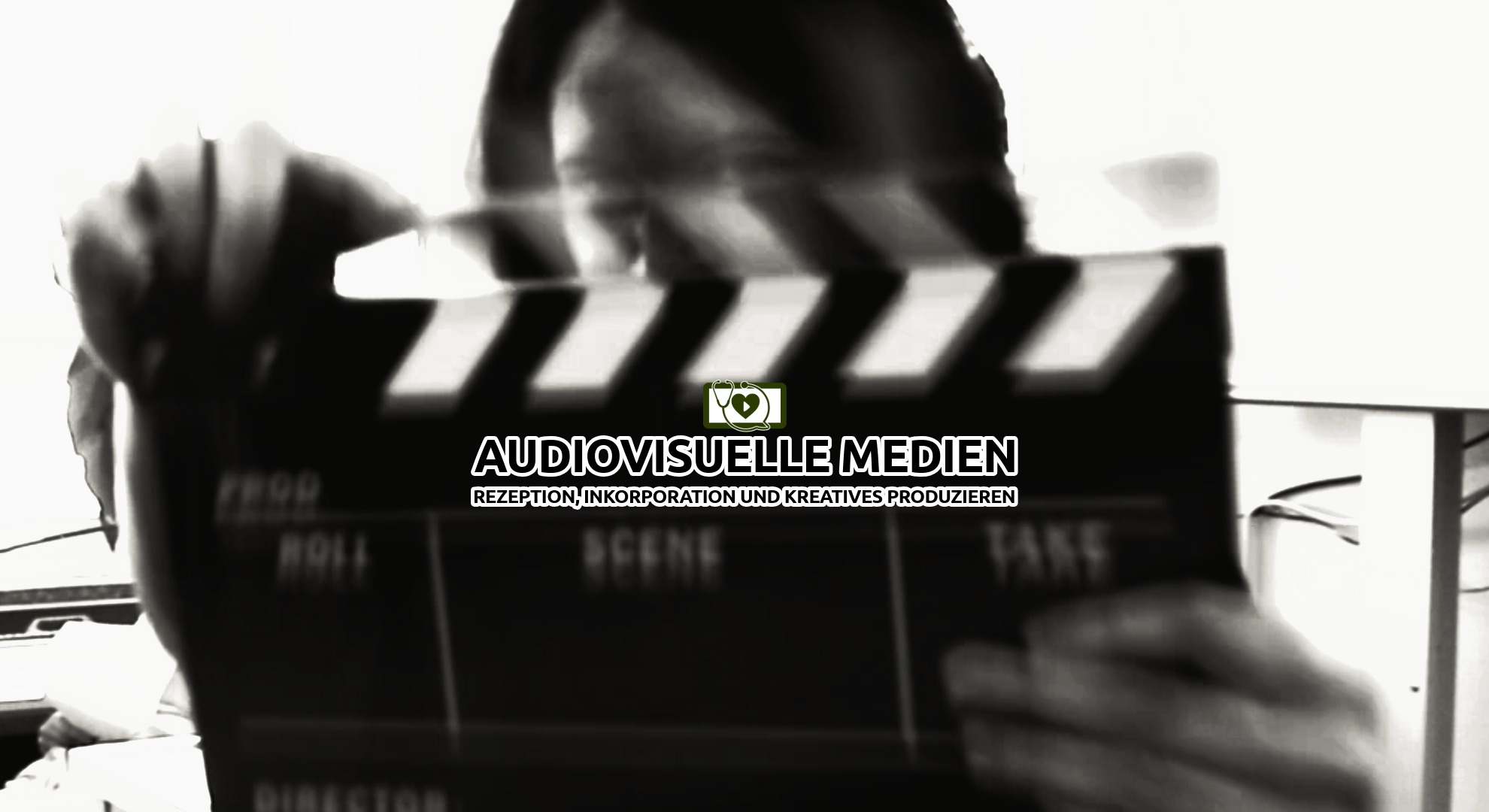
Traditionelle Medientheorien gehen mehr oder weniger von einer linearen Medienproduktion und Medienrezeption aus. Produzent*innen und Rezipient*innen, die Macher*innen und das Publikum waren klar getrennte Personenkreise und klar zugewiesene Rollen. Dass sich diese Grenzen in der heutigen Medienwelt mehr und mehr auflösen, liegt auf der Hand und braucht an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Schlagwörter wie Web 2.0 und youtube.com beinhalten eine Fülle von Grenzübergängen, die kreative Wechselwirkungen für die User*innen der multimedialen Welten bereithalten.
Genauso wie die Trennung von „lokal“ und „global“ nicht länger aufrechterhalten werden kann, so sind birgt der technische Fortschritt eine schwer zu beschreibendes Plus an kreativen Möglichkeiten des Sich-in-das-Weltgeschehen-Einmischens und sozial-relevanten Netzwerkbildung. Die Nutzer*in wird zur Produzent*in ihres eigenen Images, das sie nach außen präsentiert und nach innen eventuell auch lebt.
Was hat audiovisuelle Soziologie also nun mit der hier schon mehrfach erwähnten Kreativität zu tun?
- Gehen wir für einen Moment davon aus, dass wir mit unseren Augen und Händen denken. Unsere Augen dienen uns als Antennen in unsere soziale Außenwelt. Simmels Gedankengang, der Blickkontakt zwischen zwei Menschen sei die wohl direkteste Wechselwirkung, unterstreicht die hohe Relevanz dieses Organs zur Kreation von sozialem Leben schlechthin. Die Sichtverweigerung („Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ oder „Ich will Dich nicht mehr sehen!“) als Sanktions- und Grenzziehungsmittel zwischen Geheimnis und sozialer Offenbarung verdeutlichen den höchst gesellschaftsrelevanten Aspekt der Verwendung des Sehorgans. Imaginationen, also Vorstellungen, die vor unserem inneren Auge entstehen, stehen unmittelbar in Zusammenhang mit unseren Handlungen. Zwar wird nicht alles Imaginäre von uns in einen sozialen Tatbestand überführt, aber Wünsche und Träume, beispielsweise von der Traumfigur, setzen sich zuerst in unserem Kopf fest.
- Unsere Hände sind mit sehr vielen sensomotorischen Einheiten ausgestattet, sodass wir unsere Umwelt körperlich über den Tastsinn erfühlen können. Zwischen unserem Gehirn und unseren Händen besteht eine direkte Verbindung. Viele kreative Handlungen, die wir alltäglich und außeralltäglich vornehmen, vollziehen wir – wie das Wort Handlungen bereits vorwegnimmt- mit unseren Händen.
In den audiovisuellen Kulturen des 21. Jahrhunderts verbinden sich diese beiden Aktivitäten – Sehen und Handeln – in einer neuartigen Weise. Digitale Medienumgebungen machen das Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Produktion fließend. Das Smartphone, die Kamera, das Mikrofon, die Software zur Bild- und Tonbearbeitung sind zu alltäglichen Werkzeugen der Selbst- und Weltgestaltung geworden. Hier zeigt sich eine neue Form des inkorporierten Medienhandelns: Menschen verkörpern mediale Praktiken, indem sie Gesten, Blicke, Körperhaltungen und narrative Formen aus den Medienwelten übernehmen, imitieren, transformieren und teils neuartig kreieren.
AudioVisueller Habitus?
Audiovisuelle Medien werden damit nicht nur konsumiert, sondern körperlich und affektiv verinnerlicht. Dies lässt sich mit Bourdieus Konzept des Habitus in Verbindung bringen: Der audiovisuelle Habitus eines Individuums manifestiert sich in der Art, wie es Medieninhalte wahrnimmt, wie es sich in Szenen hineinversetzt, welche ästhetischen Präferenzen es entwickelt und wie es schließlich selbst mediale Ausdrucksformen wählt. Die wiederholte Rezeption bestimmter Bilder, Stimmen und Rhythmen prägt die sensomotorischen und affektiven Dispositionen der Nutzer*innen – Medienästhetik wird zu einem Bestandteil des gesellschaftlichen Habitus.
Die Inkorporation von Medieninhalten findet dabei auf einer mikrosozialen Ebene statt: in Gesten, Sprechweisen, in der Körperhaltung, im Blick. Eine Person, die etwa regelmäßig Vlogs konsumiert, übernimmt nicht selten bestimmte Ausdrucksformen – eine Art „visuelles Zitat“ des digitalen Alltags. Dieses Phänomen ist weniger als Nachahmung zu verstehen, sondern als kreative Aneignung. Das Subjekt wählt und variiert das medial Vorgeprägte, bringt es in neue Kontexte ein und erzeugt dadurch eine individuelle Mischung aus Eigenem und Fremdem.
Rezeption neu gedacht!
Der Begriff der Rezeption wird in diesem Zusammenhang neu gefasst. Rezeption bedeutet nicht mehr bloß Aufnahme, sondern Transformation. Die Rezipient:in ist zugleich Interpret:in, Editor:in und Performer:in. Jede Wahrnehmung ist bereits ein Prozess der Bedeutungskonstruktion und des emotionalen Engagements. Innerhalb einer das AudioVisuelle fokusierenden Soziologie könnten diese Prozesse als ästhetisch-affektive Praktiken, die soziale Realität nicht nur abbilden, sondern aktiv herstellen, umschrieben werden.
Ein anschauliches Beispiel ist die Praxis des Remixens oder Reenactments. In den sozialen Medien werden Videosequenzen nicht einfach rezipiert, sondern weiterverarbeitet. Szenen werden neu eingesprochen, nachgespielt, geschnitten und kombiniert. Dadurch entsteht ein dialogisches Verhältnis zwischen Original und Aneignung: Die Grenze zwischen Medienobjekt und sozialem Handeln verschwimmt. Medieninhalte werden zu sozialen Rohstoffen, die in alltägliche Kommunikationsprozesse eingehen.
Soziale Kreativität und ästhetische Sozialität
Dieser Zusammenhang verweist auf die zentrale Frage nach der sozialen Kreativität: Wie lässt sich Kreativität als gesellschaftlich verankerte Praxis verstehen? Kreativität erscheint in audiovisuellen Kulturen nicht länger als individuelle Gabe, sondern als eine kollektive und situative Ressource. Digitale Medienplattformen fördern kooperative Formen des Gestaltens – durch Likes, Kommentare, Duette oder Co-Produktionstools. Das kreative Handeln wird so in eine soziale Ökologie eingebettet, die von algorithmischer Sichtbarkeit, affektiver Resonanz und ökonomischen Interessen geprägt ist.
Die audiovisuelle Soziologie kann diese Dynamiken als Ausdruck einer mediatisierten Sozialität interpretieren. In der Tradition der Mediatisierungsforschung (Krotz, Hepp, Hjarvard) lässt sich argumentieren, dass mediale Ausdrucksformen in alle Lebensbereiche diffundieren und dadurch die Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit verändern. Medien sind nicht mehr externe Beobachtungsinstrumente, sondern integrale Bestandteile sozialer Praktiken. Menschen „denken“ und „fühlen“ zunehmend medial – durch Filter, durch Montage, durch den Rhythmus von Bildern und Tönen.
Hier entsteht eine Form der „ästhetischen Sozialität“, in der audiovisuelle Ausdrucksweisen soziale Beziehungen strukturieren. Das Zeigen, Teilen, Kommentieren und Nachstellen von Bildern sind Praktiken, die Zugehörigkeit herstellen, Identitäten formen und Machtverhältnisse stabilisieren oder infrage stellen. Eine Soziologie des AudioVisuellen muss daher den ästhetischen, emotionalen und technologischen Dimensionen des Sozialen gleichermaßen Beachtung schenken.
Inkorporation: Einverleiben neu gemacht!
Inkorporation meint in diesem Sinne nicht nur das Einverleiben medialer Inhalte, sondern auch die leibliche Einbindung in kommunikative Prozesse. Die Kamera lenkt den Blick, die Handbewegung formt die Geste, die Stimme passt sich an akustische Konventionen an. Das audiovisuelle Subjekt ist ein sensorisch-kreatives Wesen, das sich im Medium und durch das Medium ausdrückt.
Die digitalen Bildkulturen bringen dabei neue Formen der Authentizität hervor. Sichtbarkeit wird zu einem sozialen Kapital (Bourdieu), das auf der ästhetischen Gestaltung des Selbst basiert. Das Individuum produziert sich als visuelles Ereignis, das andere adressiert und auf Resonanz zielt. Zugleich bleibt dieses visuelle Selbst prekär – ständig gefährdet durch algorithmische Unsichtbarkeit, Kritik oder Missverständnis. Kreativität ist hier nicht nur Ausdruck, sondern auch Überlebensstrategie in einer von Bildern durchdrungenen Öffentlichkeit.
Die audiovisuelle Soziologie kann diese Entwicklungen als Ausdruck eines tiefgreifenden kulturellen Wandels verstehen: Die Grenzen zwischen Kunst und Alltag, zwischen professioneller und amateurhafter Produktion, zwischen öffentlicher und privater Kommunikation lösen sich zunehmend auf. Was früher einer kleinen medialen Elite vorbehalten war – das Sprechen in Bildern, das Gestalten von Narrationen – ist heute massenkulturelle Praxis geworden.
Damit verschiebt sich auch die Bedeutung des Sehens selbst. Sehen ist nicht mehr passiv, sondern performativ. Jeder Blick ist potenziell ein Statement, jede Kameraaufnahme ein sozialer Akt. Der mediale Blick wird zur Währung sozialer Aufmerksamkeit, die wiederum Rückwirkungen auf unsere Selbst- und Weltverhältnisse hat.
Digitale Handlungsräume: frei und doch eingeschränkt!
In diesem Zusammenhang gewinnt die Kategorie der „Affordanzen“ an Bedeutung. Digitale Plattformen bieten Handlungsräume und -grenzen, die kreative Prozesse strukturieren. Ein Video-Editor, ein Algorithmus oder ein Interface sind nicht neutral, sondern prägen, was gesehen, gesagt und gezeigt werden kann. Kreativität entfaltet sich also nie im leeren Raum, sondern innerhalb technischer und sozialer Infrastrukturen, die Handlungsmöglichkeiten eröffnen und zugleich einschränken.
Abschließend lässt sich sagen, dass audiovisuelle Medien eine komplexe Trias aus Rezeption, Inkorporation und Produktion konstituieren. Diese drei Dimensionen sind nicht hierarchisch geordnet, sondern bilden ein zirkuläres Gefüge: Wahrnehmen, Verarbeiten und Hervorbringen verschmelzen zu einem fortlaufenden Prozess sozialer Sinnproduktion.
Die audiovisuelle Soziologie steht damit vor der Aufgabe, nicht nur die Inhalte, sondern vor allem die verkörperten, affektiven und kreativen Praktiken des Mediengebrauchs zu analysieren. Das audiovisuelle Zeitalter ist ein Zeitalter des tätigen Sehens – ein sozialer Raum, in dem jeder zugleich Zuschauerin, Mitspielerin und Gestalterin ist.
Abschließend lässt sich sagen, dass audiovisuelle Medien eine komplexe Trias aus Rezeption, Inkorporation und Produktion konstituieren. Diese drei Dimensionen sind nicht hierarchisch geordnet, sondern bilden ein zirkuläres Gefüge: Wahrnehmen, Verarbeiten und Hervorbringen verschmelzen zu einem fortlaufenden Prozess sozialer Sinnproduktion.
Die audiovisuelle Soziologie steht damit vor der Aufgabe, nicht nur die Inhalte, sondern vor allem die verkörperten, affektiven und kreativen Praktiken des Mediengebrauchs zu analysieren. Das audiovisuelle Zeitalter ist ein Zeitalter des tätigen Sehens – ein sozialer Raum, in dem jeder zugleich Zuschauer:in, Mitspieler:in und Gestalter:in ist.

1 Kommentar
Interview: Klimawandel Learning For Future - Kathrin Rosi Würtz · 15. November 2025 um 10:28
[…] Audiovisuelle Medien: Rezeption, Inkorporation und kreatives Produzieren Kategorien: Ah, natürlich!Wissenschaft Schlagwörter: InterviewsWissenschaftskommunikation […]
Die Kommentare sind geschlossen.